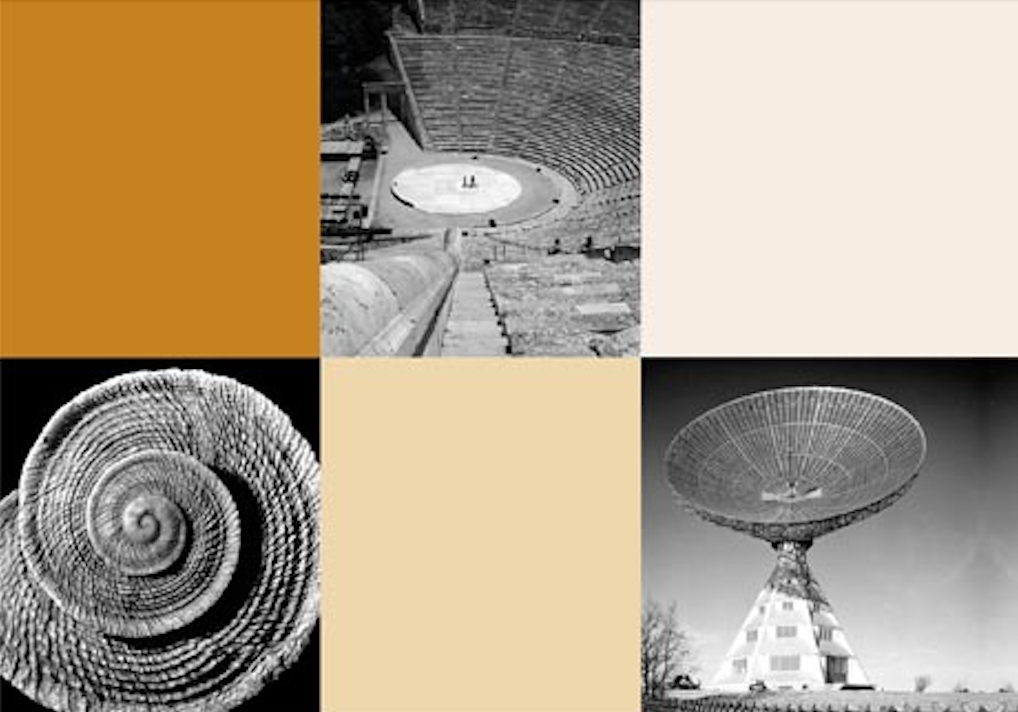
Die Vorlesung führt als Ringvorlesung umfassend in die Medienkulturgeschichte ein. Ihre Grundlage sind die Artikel des Historischen Wörterbuchs des Mediengebrauchs, das auf 3 Bände angelegt ist (2 erschienen) und vom Studiengang aus konzipiert wurde.
- Kursleiter*in: Prof. Dr. Heiko Christians
- Kursleiter*in: Dr. Susanne Müller

Wer gegenwärtig zu medientechnologischen Innovationen, Normierungen und Ordnungen forschen möchte, kommt nicht umhin sich mit der grundlegenden Neubestimmung des Verhältnisses von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Dafür müssen u.a. Orte und Prozesse beobachtet werden, die für Konsument:innen meist unzugänglich bleiben, wie die Labore und Anlagen der so genannten (Techno)wissenschaften, wo Beobachtungsinstrumente mit Experimentalsystemen und Simulationsmodellen gekoppelt sind, um „Neues“ zu entdecken und zu erfinden. Doch wie untersucht man derart komplexe Konstellationen? Dieser Frage widmen sich die Science and Technology Studies (STS) seit rund fünfzig Jahren. Aus grundlegenden Anliegen der Wissenschafts- und Techniksoziologie entstanden, erarbeiten STS-Forscher:innen innerhalb von tiefgehenden Feldstudien und daraus entstehenden Methodendiskussionen, neue Erkenntnisse, die bereits zur empirischen Grundlage vieler gegenwärtiger Wissenschafts-, Sozial- und Medienphilosophien geworden sind. Die prinzipielle Hinwendung zu sozio-materiellen Praktiken, die menschliche und nicht-menschliche Akteure gleichermaßen ins Auge fasst, steht dabei im Zentrum dieser wachsenden Forschungsdisziplin, die in zunehmend engerem wechselseitigen Austausch mit den (technischen) Medienwissenschaften steht. Im Seminar stellen wir die Frage, welche sozio-materiellen Bedingungen und Interventionen wissenschaftliche und technologische Praktiken leiten und – als Teil der umfassenden Methodenkritik innerhalb der STS – fragen wir, wie diese skalierenden Prozesse überhaupt beobachtet und beforscht werden können. Dabei lernen wir Konzepte und Methoden der STS sowie der Wissenschafts- und Techniksoziologie (Strong Programme, Social Construction of Technology „SCOT“, Actor-Network-Theory „ANT“, Praxiographie, Agentieller Realismus) sowie damit verbundene aktuelle Strömungen der Wissenschafts-, Technik- und Medienforschung (Feministische STS, Postkoloniale STS, Situierung, Neuer Materialismus) kennen.
- Kursleiter*in: Alexander Schindler
The module includes 1.) Fundamentals of science communication such as necessary press basics, the structure of a press release, and ways to communicate one's own research across all media. In addition, the module 2.) introduces the specifics of climate change communication in the tension between popularization, narratives, metaphors and the problem of climate change deniers.
Students acquire practical knowledge, skills and competences in preparing, writing and presenting scientific contexts for their later professional career, so that they are able to successfully communicate their own research in non-scientific areas in different media. They know the approaches of the field of climate communication as well as its international characteristics. They also have a deeper understanding of the political dimension of climate change communication.
- Kursleiter*in: Lena Katharina Schmidt
- Kursleiter*in: Birgit Schneider

